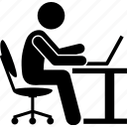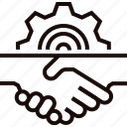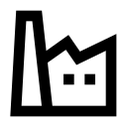Rhetorik-Training
Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern
Wirkungsvoll zu sprechen und andere zu überzeugen ist keine Frage des Talents, sondern des Trainings. In einem Rhetorik-Training wird gezielt daran gearbeitet, Sprache, Körpersprache und Auftreten bewusst einzusetzen. Klarheit, Präsenz und Überzeugungskraft stehen dabei im Mittelpunkt. So entsteht ein sicheres und authentisches Kommunikationsverhalten – ob im Gespräch, bei Präsentationen oder vor Publikum.
Gewaltfreie Kommunikation
Marshall B. Rosenberg
Ziel der GFK: „Dass alle Bedürfnisse zählen – und friedlich erfüllt werden können.“
– Marshall B. Rosenberg
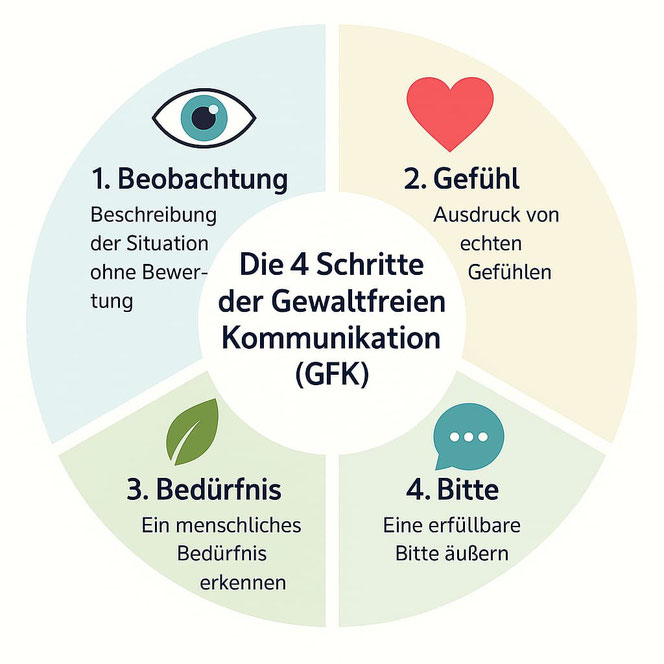
🌿 Die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)
|
Schritt |
Beschreibung |
Leitfrage |
|
1. Beobachtung 👁 |
Unvoreingenommene Beschreibung der Situation – ohne Bewertung |
Was sehe oder höre ich konkret? |
|
2. Gefühl ❤️ |
Ausdruck echter Gefühle, nicht Gedanken oder Interpretationen |
Was fühle ich in diesem Moment? |
|
3. Bedürfnis 🌱 |
Das zugrunde liegende menschliche Bedürfnis identifizieren |
Welches Bedürfnis steht hinter meinem Gefühl? |
|
4. Bitte 🗣 |
Eine klare, erfüllbare und freiwillige Bitte äußern |
Was wünsche ich mir, damit es mir besser geht? |

🧩 Zentrale Prinzipien der GFK
- Verbindung statt Urteil: Ziel ist es, eine echte Verbindung herzustellen, nicht 'Recht zu haben'.
- Empathie für sich selbst und andere: Ehrliches Einfühlen in sich selbst und das Gegenüber.
- Verantwortung übernehmen: Für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse, nicht andere dafür verantwortlich machen.
- Authentizität: Aufrichtig, ohne Schuldzuweisung, mit offenem Herzen kommunizieren.
❌ Typische Hindernisse in der Kommunikation (laut Rosenberg) • Bewertungen, Urteile und Interpretationen
- Schuldzuweisungen
- Forderungen statt Bitten
- Verleugnung von Verantwortung („Du hast mich wütend gemacht“)
Das Vier-Seiten-Modell
FRiedemann Schulz von Thun
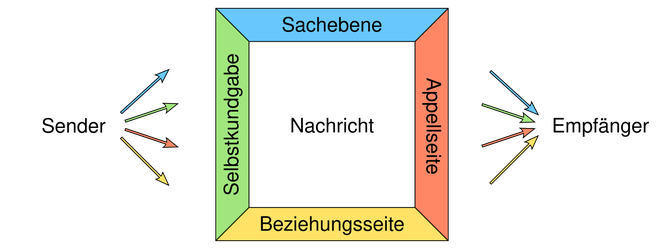
Gelingende Kommunikation
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“
– Paul Watzlawick
„Das Merkwürdige ist: Wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, dann kann ich mich verändern.“
– Carl Rogers
|
Typ |
Erkennbar an … |
Rhetorische Strategie |
Beispielhafte Reaktion |
|
Streiter / Provokateur |
Laut, aggressiv, sucht Konfrontation |
Ruhig bleiben, Konfrontation vermeiden, auf Sachebene zurückführen |
„Ich möchte das gerne sachlich klären – zurück zur Frage …“ |
|
Arroganter / Besserwisser |
Herablassend, dominant, stellt sich über andere |
Souverän widersprechen, gezielte Fragen stellen, Ironie dezent einsetzen |
„Das ist ein interessanter Standpunkt – wie genau belegen Sie das?“ |
|
Pedant / Erbsenzähler |
Hängt sich an Details auf, verliert sich im Kleinkram |
Überblick betonen, Struktur wahren, freundlich abbremsen |
„Das Detail ist wichtig – aber lassen Sie uns kurz das Gesamtbild betrachten.“ |
|
Schweiger / Introvertierter |
Wirkt verschlossen oder wenig beteiligt |
Geduld zeigen, offene Fragen stellen, Raum geben |
„Was denken Sie dazu – Ihre Sicht wäre für uns sehr wertvoll.“ |
|
Lautsprecher / Vielredner |
Redet viel, lässt andere kaum zu Wort kommen |
Höflich unterbrechen, Gespräch strukturieren |
„Darf ich kurz zusammenfassen – und dann X zu Wort kommen lassen?“ |
|
Nörgler / Negativ-Typ |
Sucht Probleme, nicht Lösungen |
Positiven Spin setzen, konstruktive Beteiligung einfordern |
„Was wäre Ihr Vorschlag für eine bessere Lösung?“ |
|
Ironiker / Zyniker |
Lacht Dinge weg, kommentiert abfällig |
Ernst bleiben, Ironie entlarven, zur Sache zurückführen |
„Lassen Sie uns die Sache ernst nehmen – sie verdient das.“ |
|
Verletzlicher / Sensibler |
Reagiert schnell gekränkt oder defensiv |
Behutsam formulieren, Ich-Botschaften, Empathie zeigen |
„Mir geht es nicht um Kritik, sondern um eine gemeinsame Lösung.“ |
|
Missionar / Überzeugter |
Will andere unbedingt bekehren, übergriffig in Meinungen |
Interesse zeigen, Grenzen setzen, nicht bekehren lassen |
„Ich verstehe Ihre Haltung – lassen Sie uns trotzdem Raum für andere Sichtweisen lassen.“ |
|
Ausweicher / Taktierer |
Wechselt Thema, bleibt vage |
Klar nachfragen, verbindliche Aussagen einfordern |
„Könnten Sie das bitte konkretisieren – worauf genau beziehen Sie sich?“ |
|
Dominanter / Alphatyp |
Gibt Ton an, beansprucht Hoheit im Raum |
Selbstbewusst auftreten, Standpunkt ruhig vertreten |
„Ich sehe das anders – und möchte das auch erklären.“ |
|
Vermeider / Harmoniesüchtiger |
Meidet Konflikte, weicht Entscheidungen aus |
Sicherheit geben, direkte Ansprache, Verantwortung einfordern |
„Ich schätze Ihre Zurückhaltung – aber wir brauchen hier Ihre klare Einschätzung.“ |
Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
Basierend auf Beispielen aus dem gleichnamigen Bestseller von Allan & Barbara Pease
🧠 Zentrale Idee
Männer und Frauen denken und kommunizieren unterschiedlich – biologisch und evolutionsbedingt. Das Buch erklärt typische Alltagssituationen auf humorvolle Weise und hilft, Missverständnisse besser zu verstehen und mit einem Lächeln zu nehmen.
🔍 Typische Beispiele
-
🗣️ Männer hören nicht zu
Beim Fernsehen nickt er, aber erinnert sich an nichts – sein Gehirn ist im „Einzeltask-Modus“. -
🚘 Frauen parken schlecht ein
Ihre räumliche Orientierung ist anders ausgeprägt – dafür merkt sie sich, wo der Pfeffer steht. -
💬 Männer lösen Probleme, Frauen reden
Er bietet sofort Lösungen an – sie will erstmal verstanden und gehört werden. -
🛒 Shopping-Stile
Sie bummelt und entdeckt – er „jagt“ gezielt und verlässt schnell das Geschäft. Eine evolutionäre Prägung? -
👀 Er sieht das Chaos nicht
Sie bemerkt jede Kleinigkeit – er wundert sich, dass etwas unordentlich sein soll.
🎯 Fazit
Was zählt, ist gegenseitiges Verständnis – mit einem Sinn für Humor, der Fähigkeit zur Selbstironie und dem Bewusstsein für die Unterschiede, die uns trennen können, aber auch Brücken schlagen.
🥚 Kommunikationsstufen: direkt - indirekt
Beispiel: Omelett zum Frühstück
Basierend auf Beispielen aus dem o.g. Buch von Allan & Barbara Pease
🛎 1. Sehr direkt – Befehl
„Mach mir ein Omelett zum Frühstück.“
🔹 Ton: Fordernd
🔹 Wirkung: Klare Ansage – keine Wahl
🔹 Mögliche Reaktion: Gehorsam, Widerstand – oder: „Mach’s dir selbst.“
💬 2. Direkt – höfliche Bitte
„Machst du mir ein Omelett zum Frühstück?“
🔹 Ton: Direkt, aber nicht unfreundlich
🔹 Wirkung: Erwartung ist deutlich, aber Spielraum bleibt
🔹 Mögliche Reaktion: „Klar, gerne.“ (mit Kaffee dazu)
🙂 3. Freundlich-indirekt – Bitte mit Rücksicht
„Könntest du mir bitte ein Omelett zum Frühstück machen?“
🔹 Ton: Höflich, respektvoll
🔹 Wirkung: Höhere soziale Akzeptanz, wirkt nicht fordernd
🔹 Mögliche Reaktion: „Natürlich – wie magst du’s?“
🤔 4. Indirekt – gemeinschaftlich verpackt
„Meinst du nicht, wir sollten ein Omelett zum Frühstück essen?“
🔹 Ton: Vorschlag statt Wunsch
🔹 Wirkung: Das Bedürfnis wird versteckt formuliert
🔹 Mögliche Reaktion: „Können wir machen – willst du’s machen?“
💡 5. Subtil – Vorschlag mit Fragecharakter
„Was hältst du von einem Omelett zum Frühstück?“
🔹 Ton: Leicht, vage
🔹 Wirkung: Offene Kommunikation, aber unklar, wer es machen soll
🔹 Mögliche Reaktion: „Klingt gut. Hast du Lust?“
🕯 6. Sehr indirekt – Wunsch als Kommentar
„Ein Omelett zum Frühstück wäre schon etwas Feines.“
🔹 Ton: Rein emotional, keinerlei Aufforderung
🔹 Wirkung: Romantische Stimmung – aber keine Handlung
🔹 Mögliche Reaktion: „Stimmt. Vielleicht morgen?“
🎯 Fazit – Zusammenfassung
„Wie klar ein Wunsch formuliert ist, bestimmt, ob er verstanden wird.“
🔹 Ton: Klar, aber je nach Ausdruck freundlich oder fordernd
🔹 Wirkung: Verständlichkeit steigt mit Klarheit, Zustimmung mit Höflichkeit
🔹 Mögliche Reaktion: Wird der Wunsch klar und respektvoll geäußert, steigt die Bereitschaft zur Erfüllung – Omelett inklusive.
© Dr. Bernd Wrede. Diese Struktur ist urheberrechtlich geschützt. Eine kommerzielle Nutzung durch Dritte ist ohne Zustimmung des Autors untersagt.