Gen Z im Qualitätsstresstest
DIHK-Daten 2025 über Grundkompetenzen im dualen System
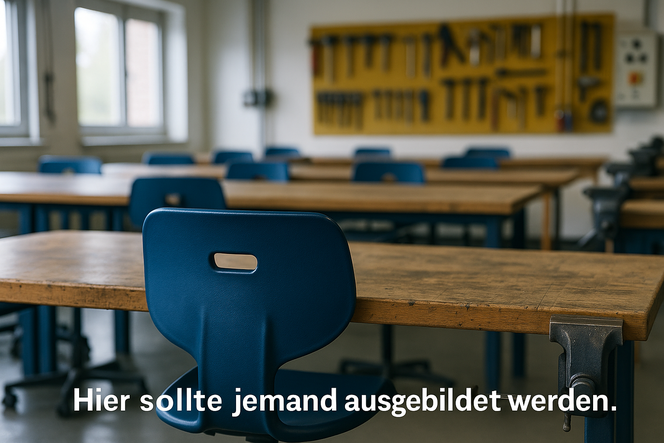
I. Ausgangslage - Das Lagebild in Zahlen
Stichprobe und Signale
14 994 ausbildende Betriebe nahmen im Mai 2025 an der DIHK‑Ausbildungsumfrage teil.
48 % konnten mindestens eine ausgeschriebene Stelle nicht besetzen. Unter diesen Betrieben fanden 73 % keine geeigneten Bewerber.
26 % der ausbildenden Betriebe reduzieren ihr Angebot an Ausbildungsstellen; Hauptgrund sind Eignungsdefizite, nicht mangelnde Nachfrage.
Qualifikationsdefizite im Überblick (Mehrfachnennungen waren möglich)
| Kompetenzfeld | „Häufige Defizite“ | Trend ggü. 2024 |
|---|---|---|
|
Belastbarkeit/ Arbeits‑ u. Sozialverhalten |
56 % | +2 Ppt. |
| Mentale Leistungsfähigkeit | 46 % | +1 Ppt. |
| Deutsch, mündlich und schriftlich | 44 % | unverändert |
| Elementare Mathematik | 43 % | +1 Ppt. |
Konsequenzen im Betrieb
14 % lösten Ausbildungsverträge innerhalb der Probezeit auf; weitere 11 % der zugesagten Ausbildungen wurden von Bewerbern nicht angetreten.
Zwei Drittel der Betriebe investieren nun zusätzlich in Nachhilfe und Grundlagenförderung statt in Fachvertiefung.
II. Analyse - Ökonomische und gesellschaftliche Einordnung
Erosion des Humankapitals
Die Umfrage bestätigt einen Mangel von geeigneten Bewerbern am Ausbildungsmarkt. In ökonomischer Terminologie liegt eine Passungslücke vor. Das Arbeitskräfteangebot der Generation Z passt in
wesentlichen Grundkompetenzen nicht mehr zur betrieblichen Nachfrage.
Produktivitätsrisiko
Fehlende Basisfähigkeiten erhöhen die Grenzproduktkosten der Ausbildung. Betriebe internalisieren diese Zusatzkosten, indem sie weniger Lehrstellen ausschreiben. Weniger ausgebildetes
Humankapital senkt mittelbar die Totalfaktorproduktivität der Volkswirtschaft, da die Qualität der Arbeitskräfte eine der wesentlichsten Einflussgrößen im Produktionsprozess darstellt. Das
langfristige Potenzialwachstum nimmt ab, sobald sich diese Qualifikationslücke verfestigt.
Systemische Ursachen
-
Erziehungsökonomik: elterliche Überbehütung oder Unterforderung mindert Resilienz und Selbstwirksamkeit.
-
Schulcurricula: Kompetenzorientierung ohne Leistungsanreize schwächt Grundlagen in Sprache und Rechnen.
- Verengung der Schulbildung auf kognitive Inhalte und Digitalisierung vernachlässigt sowohl Sozialverhalten, insbesondere Ordnung, Fleiß, Mitarbeit und Disziplin, als auch physische und psychische Belastbarkeit.
-
Informationsasymmetrie: fehlende Berufswahlkompetenz – nur 22 % der Betriebe sehen hier selten Mängel – führt zu Fehlallokation von Talenten.
Makroökonomische Rückkopplung
Geringe Passung führt zu weniger Ausbildungsplätzen, was den Fachkräftemangel vergrößert und damit das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft belastet.
III. Operative Bewertung
| Kriterium | Lagebeurteilung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Leistungsfähigkeit der Schulabgänger | kritisch | erhöhtes Ausbildungsrisiko |
| Betriebliche Ausbildungsbereitschaft | abnehmend | Kapazitätsrückgang |
| Arbeitsmarktnachfrage | hoch | Lücke bleibt bestehen |
| Politische Gegenmaßnahmen | fragmentiert | Wirkung unzureichend |
IV. Handlungsempfehlungen - Kurskorrektur in drei Linien
Linie 1: Grundlegung in Schule und Berufsschule
-
Rückkehr zu kumulativen Lehrplänen für Lesen, Schreiben und Rechnen sowie eine verbindliche Stärkung der körperlichen Ertüchtigung als Teil der Persönlichkeitsbildung. Benotung des Sozialverhaltens.
-
Lehrkräftefortbildung in leistungsdiagnostischen Verfahren.
-
Kennzahlengestützte Erfolgskontrolle der Grundkompetenzen in Klasse 9.
Linie 2: Duale Ausbildung als Integrationsoffensive
-
Verbindliche Brückenkurse in Deutsch, Mathematik und Sozialverhalten im ersten Halbjahr der Ausbildung, finanziert über einen Fonds „Basiskompetenz“.
-
Ausbau betriebspädagogischer Module bei den Industrie- und Handelskammern.
-
Mentorenprogramme für sozial benachteiligte Schulabgänger.
Linie 3: Strategische Personalaufklärung
-
Frühzeitige Berufsorientierung ab Klasse 7, praxisnah und digital gestützt. Leitbild ist der Generalist mit polytechnischer Grundausbildung im Sinne des Humboldtschen Bildungsideals – anständig, verlässlich, anpassungsfähig, technisch versiert und unternehmerisch denkend.
-
Einführung eines bundesweiten Indikators „Berufswahlkompetenz“ im Bildungsmonitoring, ergänzt um einen zusätzlichen Index „Polytechnische Basiskompetenz“, der Grundfertigkeiten in Technik, Digitalem und Ökonomie misst.
V. Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der DIHK‑Umfrage markieren keinen Abgesang, sondern eine dringliche Handlungsaufforderung. Drei Leitlinien sind entscheidend:
1. Kernkompetenzen priorisieren
Lesen, Schreiben, Rechnen sowie Sozialverhalten bilden die Grundlagen. Ihre lückenlose Beherrschung ist die Zugangsvoraussetzung für jede Ausbildung. Zur Grundlegung gehört auch die körperliche
Ertüchtigung als Training von Disziplin, Ausdauer und Selbstwirksamkeit. Sie stärkt das Fundament beruflicher Belastbarkeit.
2. Verbundverantwortung stärken
Betriebe liefern Praxis und Mentoring, Schulen sichern Theorie und Methodik, Elternhäuser stützen Disziplin und Werte. Nur im Dreiklang entsteht belastbares Humankapital.
3. Fortschritt messbar machen
Jährliche Kompetenzbilanzen, transparente Benchmarks und ein Bildungspakt 2030 setzen Druck und Orientierung, wie eine Einsatzplanung mit klaren Meilensteinen.
Das verbleibende Zeitfenster zur Stärkung der Grundausstattung der Generation Z wird auf fünf bis zehn Jahre geschätzt. Eine rechtzeitige Neuausrichtung der Bildungspraxis ist entscheidend, um langfristig Produktivität und Wohlstand zu sichern.
Quellenverzeichnis
-
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) (2025): Ausbildungsumfrage 2025. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung. Berlin.
-
DIHK (2025): Pressemitteilung „Fachkräftemangel spitzt sich zu – Betriebe finden immer weniger geeignete Azubis“, 4. Juli 2025.
-
Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken (2025): Ausbildungsumfrage 2025 – Regionale Auswertung. Heilbronn.
-
IHK Nord Westfalen (2025): Ausbildungsreport 2025. Münster.
