Arbeit 4.0
Einsatzfelder und Nutzenpotentiale humanoider Roboter
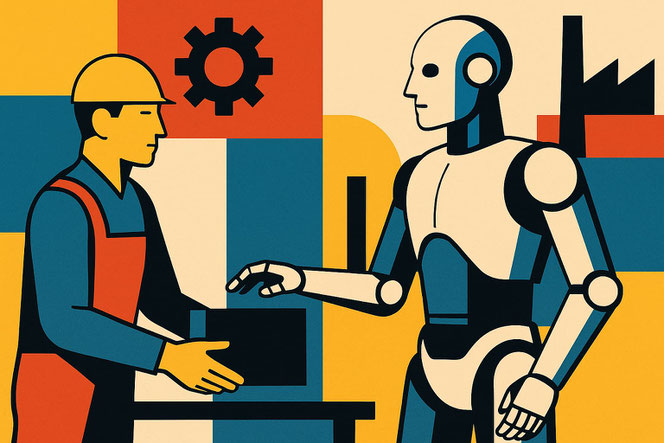
Einleitung
Humanoide Maschinen – also menschenähnlich gestaltete Roboter – sind längst keine Vision aus der Science-Fiction mehr. In technologisch führenden Staaten wie China, den USA und Japan übernehmen sie bereits konkrete Aufgaben, die bisher Menschen vorbehalten waren.
Angesichts wachsender Personalengpässe, steigender Anforderungen an Effizienz und Flexibilität sowie des demografischen Wandels erscheint es plausibel, dass humanoide Roboter künftig als neue Form von Arbeitskraft an Bedeutung gewinnen werden.
Doch was unterscheidet sie von anderen Maschinen? Wo sind sie bereits im Einsatz? Und welche Herausforderungen bringt ihre Integration mit sich?
Vor diesem Hintergrund bietet sich eine Betrachtung ihrer Einsatzmöglichkeiten in konkreten gesellschaftlichen Sektoren an.
I. Sektorale Einsatzfelder humanoider Robotik
Die technologische Entwicklung humanoider Robotik lässt sich exemplarisch anhand des Einsatzes in sechs zentralen Sektoren betrachten: Raumfahrt und Forschung, Industrie, Landwirtschaft, Handwerk, Pflege und Medizin sowie Militär und Gefahrenabwehr. In jedem dieser Bereiche treten unterschiedliche Anforderungen, technische Reifegrade und arbeitsorganisatorische Dynamiken zutage.
1. Raumfahrt und Forschung
Raumfahrt und Forschung bilden traditionell das technologische Schaufenster für humanoide Robotik, da hier die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Autonomie und Einsatzflexibilität besonders hoch sind. In diesem anspruchsvollen Umfeld kommen daher bereits heute humanoide Systeme zum Einsatz, um menschliche Risiken zu reduzieren, ferngesteuerte Einsätze zu ermöglichen und autonome Fähigkeiten zu erproben.
Die NASA treibt beispielsweise mit ihrem humanoiden Roboter „Valkyrie“ die autonome Erkundung und Wartung in Weltraumumgebungen voran. Valkyrie verfügt über 44 Freiheitsgrade und kann sowohl autonome Bewegungen durchführen als auch komplexe Werkzeuge bedienen. Der Roboter soll langfristig Wartungs- und Aufbauarbeiten auf zukünftigen Mond- und Marsmissionen übernehmen. Hierzu zählen die autonome Reparatur von Satelliten, die Errichtung und Wartung von habitablen Stationen oder die wissenschaftliche Datenerfassung in gefährlichen Einsatzgebieten.
Russland verfolgt mit dem Roboter FEDOR („Final Experimental Demonstration Object Research“) ein ähnliches Ziel. FEDOR absolvierte bereits erfolgreich Einsätze auf der Internationalen Raumstation (ISS), bei denen grundlegende autonome Bewegungsabläufe und Interaktionen mit Werkzeugen demonstriert wurden. Diese Erfahrungen fließen direkt in die Entwicklung künftiger bemannter und unbemannter Raumfahrtsysteme ein, die auf zuverlässige humanoide Unterstützung angewiesen sein werden.
Auch Japan gehört zu den Vorreitern in der Weltraumrobotik: Der Roboter „Kirobo“, entwickelt von Toyota und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA, interagierte bereits erfolgreich mit Astronauten an Bord der ISS. Ziel der Entwicklung solcher humanoider Roboter ist es nicht nur komplexe mechanische Aufgaben zu erledigen, sondern auch die soziale Interaktion und psychologische Unterstützung während Langzeitmissionen zu ermöglichen.
Darüber hinaus investiert die europäische Raumfahrtagentur ESA in Forschungsprojekte, die humanoide Systeme für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf Satellitenplattformen und orbitalen Stationen qualifizieren sollen. Ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der autonomen Navigation und Interaktion mit unbekannten und wechselnden Umgebungen, die hohe Anforderungen an künstliche Intelligenz, visuelle Sensorik und adaptive Steuerungstechnik stellen.
Der technologische Fortschritt humanoider Roboter in Raumfahrt und Forschung wirkt dabei oft als Katalysator für Anwendungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Erkenntnisse aus Weltraumprojekten übertragen sich direkt auf industrielle, medizinische und sicherheitsbezogene Anwendungen und fördern somit eine umfassende technologische Entwicklung.
2. Industrie
In industriellen Anwendungen zeigt sich der Nutzen humanoider Roboter besonders deutlich. Ihre menschenähnliche Gestaltung ermöglicht die Integration in bestehende Infrastrukturen, ohne dass
wesentliche Anpassungen erforderlich sind. Sie agieren in räumlichen, logistischen und funktionalen Zusammenhängen, die ursprünglich nur auf die menschliche Arbeitskraft ausgelegt
waren.
Beispielhaft ist der „Walker S2“ des chinesischen Unternehmens UBTech, der nicht nur einfache Montagetätigkeiten verrichtet, Objekte greift, hebt und transportiert, sondern aufgrund seines
automatischen Akkuwechsels rund um die Uhr arbeiten kann. Auch Teslas Modell „Optimus“ ist für repetitive Aufgaben in Produktionsumgebungen vorgesehen, ebenso wie das auf Logistik spezialisierte
Modell „Digit“ von Agility Robotics.
Im Unterschied zu spezialisierten Systemen, die auf klar definierte Prozessschritte beschränkt bleiben, sind humanoide Roboter in der Lage, zwischen unterschiedlichen Aufgabenfeldern zu wechseln, eigenständig Störungen zu identifizieren und flexibel auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Damit leisten sie sowohl einen Beitrag zur Effizienzsteigerung als auch zur Resilienz industrieller Produktionsprozesse.
3. Landwirtschaft
Im landwirtschaftlichen Bereich dominiert bislang der Einsatz spezialisierter autonomer Systeme wie beispielsweise in der Bodenbearbeitung, Saatgutverteilung oder automatisierten Ernte. Humanoide Maschinen sind dort noch selten im praktischen Einsatz, rücken jedoch im Rahmen internationaler Forschung zunehmend in den Fokus. Ihre potenzielle Stärke liegt in der Möglichkeit, bestehende betriebliche Infrastrukturen ohne umfassende Umbauten zu nutzen.
Verschiedene Projekte zeigen, dass humanoide Roboter perspektivisch Aufgaben übernehmen könnten, die manuell anspruchsvoll, saisonal konzentriert oder gesundheitlich belastend sind.
In Japan arbeitet das RIKEN-Guardian-Robot-Lab an humanoiden Systemen für das gezielte Ernten empfindlicher Früchte wie Pfirsiche oder Erdbeeren, deren Lage und Reifegrad über Bilderkennung analysiert werden. Der Roboter kann sich zwischen den Reihen bewegen, die Frucht mit kontrolliertem Druck greifen und direkt in Verpackungen legen.
Die Ben-Gurion-Universität in Israel untersucht humanoide Prototypen, die Werkzeuge selbstständig wechseln und Pflanzenpflege, Bewässerung oder Schädlingskontrolle unter Gewächshausbedingungen durchführen können. Der humanoide Aufbau erlaubt das Agieren in beengten Gängen und zwischen unterschiedlich hohen Pflanzenstrukturen.
In den USA finanziert das Department of Agriculture ein Projekt zur Entwicklung humanoider Wartungsroboter für Traktoren und automatische Melksysteme. Hier liegt der Fokus auf Bedienungskontexten, die physisch fordernd oder ergonomisch ungünstig für Menschen sind.
Diese Entwicklungen sind noch nicht serienreif, verdeutlichen aber die technische und funktionale Anschlussfähigkeit humanoider Systeme an hochmechanisierte Agrarbetriebe, insbesondere dort, wo saisonale Arbeitskräfte knapp oder wirtschaftlich schwer kalkulierbar sind.
4. Handwerk
Auch im handwerklichen Bereich entstehen erste Anwendungsfelder für humanoide Robotik. Roboter, die einfache Bau-, Streich- oder Verlegearbeiten ausführen können, sind technisch realisierbar und zunehmend marktnah.
Teslas Modell „Optimus“ und „Digit“ von Agility Robotics kommen perspektivisch ebenso im Handwerk und Transport zum Einsatz, wo sie körperlich belastende Aufgaben übernehmen könnten. Durch die Kombination von feinmotorischer Sensorik, adaptiver Steuerungstechnik und räumlicher Orientierung sind sie in der Lage, standardisierte, körperlich belastende oder repetitive Tätigkeiten zuverlässig zu übernehmen. Dies schafft Potenzial zur Entlastung qualifizierter Fachkräfte und eröffnet langfristig neue Formen arbeitsteiliger Organisation im kleinteiligen Bau- und Ausbaugewerbe.
5. Pflege und Medizin
Am weitesten fortgeschritten ist der Einsatz humanoider Roboter im Bereich der Pflege und medizinischen Assistenz. Der in Pflegeheimen eingesetzte Roboter „Pepper“ von SoftBank Robotics interagiert mit den Bewohnern, erinnert an Medikamenteneinnahmen und leitet Bewegungsübungen an. Weitere Systeme unterstützen bei physisch belastenden Tätigkeiten wie dem Aufrichten, Umlagern oder Transport von Pflegebedürftigen. Die technische Assistenz ersetzt dabei nicht menschliche Zuwendung, sondern wirkt dort unterstützend, wo personelle Kapazitäten an Grenzen stoßen.
6. Militär und Gefahrenabwehr
Im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich gilt humanoide Robotik als Schlüsseltechnologie, weil sie lebensgefährliche oder körperlich belastende Aufgaben auf Maschinen übertragen kann. Zahlreiche Staaten investieren in Systeme, die für komplexe Einsatzszenarien qualifiziert werden sollen – von der Brandbekämpfung bis zum Kampfeinsatz. Bereits im Einsatz- oder Teststadium befinden sich humanoide Plattformen mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:
- Bergung und Rettung
-
- BEAR (Vecna Robotics, USA) kann bis zu 250 kg heben und dient der Evakuierung verwundeter Soldaten aus Gefechtszonen.
- SAFFiR (U.S. Navy) ist für Brandbekämpfung und Notfallreaktion auf Schiffen konzipiert. Er reagiert auf Sprach- und Gestenbefehle, öffnet Türen und bewegt sich auf engem Raum.
- Gefahrenbeseitigung und logistische Unterstützung
-
- Die indische DRDO entwickelt humanoide Systeme zur Entschärfung improvisierter Sprengsätze (IEDs) und zur Handhabung gefährlicher Substanzen.
- In China testet Unitree Robotics eine bipedale Plattform, die Munitionskisten trägt, mobile Funkantennen aufbaut und unwegsames Gelände überwindet.
- Humanoide Systeme für Kampfeinsätze
-
- Russland: Der „Marker“-Humanoid wird mit einem 7,62-mm-Sturmgewehr ausgerüstet und für Feuerunterstützung im urbanen Raum erprobt.
- China: Der Rüstungskonzern NORINCO stellte 2024 ein Konzept für einen zweibeinigen Gefechtsroboter mit modularem Waffenmodul vor.
- USA: Im Rahmen des DARPA-Projekts „Robo-Century Soldier“ wird eine human-in-the-loop-Plattform als vorgeschobener Sensor und Feuerleitstelle entwickelt. Die erweiterte SAFFiR-X-Version testet den Einsatz nicht-tödlicher Deckungsmunition.
- Diese Programme verdeutlichen die strategische Zielrichtung: Humanoide Plattformen sollen in der Aufklärung, Logistik und beim Waffeneinsatz langfristig als Teil militärischer Gefechtsunterstützung agieren.
- Exkurs: Quadrupede Systeme
-
- Neben humanoiden Robotern gewinnen auch quadrupede Systeme an Bedeutung. Sie zeichnen sich durch hohe Geländegängigkeit, modulare Nutzlastfähigkeit und robuste Einsatzdauer aus, besitzen aber keine feinmotorischen Manipulatoren wie humanoide Systeme.
- Aufklärung / Überwachung: Ghost Robotics Vision 60 (USA) - Seit 2023 auf US-Luftwaffenbasen; 2024 mit KI-gestütztem Scharfschützenmodul getestet.
- Bewaffnete Gefechtsunterstützung: Vision 60 + SPUR-Gewehr (USA); Q-UGV Wolf (China) - Prototypen mit Fernsteuerung und begrenzter Autonomie (2024/ 25).
- Logistik/ Verwundetentransport: ANYmal C (Schweiz); mod. Unitree B1/ H1 - NATO-Gebirgsübungen; positive Rückmeldung zur Steigleistung.
- Spezialaufgaben: Robotic Coyote (US-Army ERDC) - Serienseinsatz seit Juli 2025 zur Flugfeldsicherung durch Vogelvergrämung.
- Quadrupede Roboter bieten insofern Vorteile bei Reichweite, Gelände und Ausdauer, sind jedoch in ihrer Interaktion mit Objekten limitiert. Hinsichtlich völkerrechtlicher Bewertung gelten für sie dieselben Maßstäbe wie für bewaffnete humanoide Systeme.
-
- Die technische Grenze zwischen Assistenzsystemen und autonom agierenden Waffeneinheiten ist fließend. Internationale Foren wie die UN-Konvention über konventionelle Waffen (CCW) debattieren seit 2014 über verbindliche Normen für Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS).
- Ohne klare internationale Rahmensetzung droht die militärische Robotik nicht nur zivile Anwendungspotenziale zu überlagern, sondern neue sicherheitspolitische Risiken zu erzeugen. Eine ethisch fundierte Debatte über Rolle, Grenzen und Verantwortlichkeit autonom agierender Waffensysteme steht weiterhin aus.
II. Nutzenpotenziale humanoider Systeme
Unabhängig vom jeweiligen Einsatzfeld lassen sich übergreifende Leistungsmerkmale humanoider Systeme zusammenfassen: Ihre menschenähnliche Konstruktion verleiht ihnen ein Maß an Anpassungsfähigkeit, das über die Einsatzmöglichkeiten konventioneller Robotik hinausgeht. Entscheidend ist nicht allein ihre technische Leistungsfähigkeit, sondern der strukturelle Vorteil, den sie in arbeitsorganisatorischer, ergonomischer und prozessualer Hinsicht mit sich bringen.
Dazu lassen sich fünf zentrale Funktionsdimensionen bestimmen:
-
Belastungsresistenz und Dauerverfügbarkeit
Humanoide Systeme sind nicht an biologische Rhythmen gebunden. Sie ermöglichen einen kontinuierlichen Einsatz unter konstanten Leistungsbedingungen, ohne Ermüdung oder gesundheitliche Einschränkungen. -
Standardisierung und Prozessstabilität
Ihre Programmierbarkeit erlaubt eine hohe Wiederholgenauigkeit und Prozesskonstanz. Dies steigert die Effizienz in gleichförmigen Abläufen und senkt die Fehleranfälligkeit in standardisierten Prozessen. -
Komplementarität menschlicher Arbeit
Humanoide Roboter erweitern die Handlungsfähigkeit menschlicher Arbeitskräfte, indem sie monotone, körperlich belastende oder sicherheitskritische Tätigkeiten übernehmen. Ihre Integration führt nicht zur Verdrängung, sondern zur funktionalen Erweiterung arbeitsteiliger Systeme. -
Infrastrukturkompatibilität und Adaptivität
Durch ihre anthropomorphe Gestaltung können humanoide Systeme in bestehenden, auf den Menschen zugeschnittenen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden. Bauliche Anpassungen sind in der Regel nicht erforderlich. -
Autonomie und Systemintelligenz
Fortschritte in künstlicher Intelligenz, Sensorik und Entscheidungslogik ermöglichen eine zunehmende Selbststeuerung. Die Systeme sind in der Lage, auf sich verändernde Umgebungsbedingungen zu reagieren, Fehler zu erkennen und Entscheidungen innerhalb definierter Handlungsrahmen selbstständig zu treffen.
In ihrer Gesamtheit markieren diese Eigenschaften einen technologischen Übergang. Humanoide Roboter sind keine Maschinen im klassischen Sinn, sondern operative Instanzen einer neuen Arbeitsarchitektur. Sie verkörpern eine Zwischenform, die sowohl menschliche Fähigkeiten technisch nachbildet als auch neue Formen der Prozessgestaltung ermöglicht.
Ihre ökonomische Bedeutung liegt daher nicht allein in der Steigerung betrieblicher Effizienz, da sie fähig sind, Arbeitsprozesse neu zu konfigurieren. Dies betrifft insbesondere Anforderungen an Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit und nahtlose Systemintegration.
Die Frage, ob oder inwieweit humanoide Systeme ihr volles Potenzial entfalten können, wird daher nicht nur durch ihre technische Reife bestimmt werden, sondern durch die Fähigkeit von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, sie in ein kohärentes und verantwortungsvolles Ordnungssystem einzubetten. Hierzu gehören unter anderem Investitionen in Forschung und Qualifikation, rechtliche Klarheit hinsichtlich Haftung und Datenschutz sowie eine ethisch fundierte Debatte über den künftigen Stellenwert technischer Agenten im Gefüge menschlicher Arbeit.
III. Herausforderungen und strukturelle Grenzen
Trotz dieser Potenziale bestehen nach wie vor technische, wirtschaftliche und ethische Herausforderungen:
-
Kosten: Hochentwickelte humanoide Roboter sind bislang teuer in der Herstellung und Wartung, auch wenn die Preise durch Massenproduktion sinken könnten.
-
Energie und Laufzeit: Nur wenige Modelle – wie der „Walker S2“ – verfügen über autonome Akkuwechselsysteme, die einen Dauerbetrieb erlauben.
-
Sicherheit und Haftung: Die Verantwortung für Fehlfunktionen oder Schäden durch autonome Maschinen erfordert eine klare juristische Zuordnung, die Herstellerhaftung, Betreiberverantwortung und algorithmische Entscheidungsstrukturen gleichermaßen berücksichtigt.
-
Arbeitsmarkt und Bildung: Der Einsatz humanoider Roboter verändert die Berufsbilder. Neue Qualifikationen werden notwendig, viele Tätigkeiten werden verschwinden.
-
Ethische Fragen: In Pflege und Militär stellen sich Fragen nach Menschenwürde, Entscheidungshoheit und der Grenze maschineller Intervention.
IV. Politökonomische Implikationen und Steuerungsbedarf
Die zunehmende Verbreitung humanoider Systeme verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch die institutionellen Bedingungen moderner Arbeitsgesellschaften. Diese Entwicklung verlangt eine proaktive wirtschafts- und ordnungspolitische Rahmensetzung. Drei Handlungsfelder erscheinen besonders dringlich:
-
Verteilung von Zugang und Eigentum: Der Zugang zu hochentwickelter Robotik konzentriert sich derzeit auf wenige Akteure. Ohne regulatorischen Ausgleich drohen asymmetrische Marktstrukturen und neue Formen digitaler Machtkonzentration.
-
Transformation beruflicher Qualifikation: Der Wandel verlangt nicht nur technische Ausbildung, sondern auch interdisziplinäre Kompetenzentwicklung, etwa im Umgang mit KI-gesteuerten Systemen, ethischer Urteilsfähigkeit und adaptiver Führung.
-
Regulierung autonomer Entscheidungsprozesse: Je größer der operative Handlungsspielraum humanoider Maschinen wird, desto wichtiger werden normative Leitplanken. Dies betrifft Haftung, Datenschutz, Transparenz sowie die menschenrechtliche Begrenzung algorithmischer Gewalt.
Der gesellschaftliche Mehrwert humanoider Robotik bemisst sich nicht an ihrer technischen Leistungsfähigkeit, sondern an ihrer Einbindung in ein gerechtes, kompetenzförderndes und normativ abgesichertes Arbeitsgefüge.
V. Schlussfolgerungen
Humanoide Roboter sind längst keine Zukunftsvision mehr. Sie treten zunehmend als leistungsfähige Akteure in einer sich wandelnden Arbeitswelt hervor. Ihre besondere Stärke liegt in der Verbindung technischer Autonomie mit menschenähnlicher Beweglichkeit und funktionaler Anpassungsfähigkeit. Einsatz finden sie nicht ausschließlich in der Industrie, sondern zunehmend auch im Handwerk, in Pflegeberufen, im Dienstleistungssektor und in sicherheitsrelevanten Bereichen. Ihr Erfolg wird nicht durch technologische Reife allein bestimmt, ebenso wenig genügt gesellschaftliche Aufgeschlossenheit. Entscheidend ist vielmehr, ob Wirtschaft, Politik und Bildungsinstitutionen rechtzeitig die nötigen Voraussetzungen schaffen können. Dazu gehören zielgerichtete Investitionen, die systematische Qualifizierung der Arbeitskräfte und eine sorgfältige Auseinandersetzung mit der ethischen Rolle maschineller Systeme im Kontext menschlicher Arbeit. Andernfalls bleibt das Potenzial dieser Entwicklung ungenutzt.
PS (18.08.2025): Bis 2050 könnten nach einer Studie von Morgan Stanley weltweit rund 1 Milliarde humanoide Roboter im Einsatz sein, was einem jährlichen Marktvolumen von bis zu 5 Billionen US-Dollar entspricht. Für die USA wird ein Bestand von rund 63 Millionen humanoiden Robotern prognostiziert. Für China 300 Millionen. Für Deutschland liegen keine belastbaren Zahlen vor.
Quellenverzeichnis
I. Sektorale Einsatzfelder humanoider Robotik
Raumfahrt und Forschung
-
NASA. “Valkyrie Robot.” Robotics247. https://www.robotics247.com.
-
Roscosmos. “FEDOR: Final Experimental Demonstration Object Research.” Robotics247. https://www.robotics247.com.
-
Toyota/JAXA. “Kirobo: Japan’s Humanoid Robot Astronaut.” RIKEN Group. https://www.grp.riken.jp.
-
European Space Agency (ESA). “Interact/Automation & Robotics Lab.” ESA Technology. https://www.technology.esa.int.
-
European Space Agency (ESA). “RISE In-Orbit Servicing Mission.” https://www.esa.int.
Industrie
-
UBTech. “Walker S2 Robot: Video and Report.” Robotics247, News.com.au. https://www.robotics247.com.
-
Tesla. “AI Day Presentation and Q1 2025 Investor Report.” https://www.tesla.com; https://ir.tesla.com.
-
Agility Robotics. “Digit Humanoid Robot.” https://www.agilityrobotics.com/robots#digit.
Landwirtschaft
-
RIKEN Institute. “Guardian Robot Project.” https://www.grp.riken.jp.
-
Ben-Gurion University. “Agri-Robotics and Humanoid Prototypes.” https://www.bgu.ac.il.
-
United States Department of Agriculture (USDA). “AFRI Robotics Initiative.” https://www.usda.gov.
- Russian Cyber Farm. https://www.youtube.com/watch?v=9G2-RnH_RkM
Handwerk
-
Tesla, Agility Robotics. Siehe unter “Industrie.”
Pflege und Medizin
-
SoftBank Robotics. “Pepper: Social Humanoid Robot.” https://www.softbankrobotics.com/pepper.
-
Broadbent, Elizabeth, et al. “Robots in Elder Care: A Review of Acceptance by Older People.” International Journal of Social Robotics 1, no. 4 (2009): 319–330.
Militär und Gefahrenabwehr
-
United States Navy. “Autonomous Shipboard Humanoid: SAFFiR & SAFFiR-X.” Naval Research Laboratory. https://www.nrl.navy.mil/autonomy.
-
Vecna Robotics. “BEAR Tactical Rescue Robot.” https://www.vecnarobotics.com.
-
DARPA. “BAA HR0011-25-R-0032: Robo-Century Soldier.” https://www.darpa.mil.
-
Android Technics. “Marker Humanoid Robot (Russia).” https://www.android-technics.ru.
-
NORINCO. “Biped Combat Robot Concept (China).” Zhuhai Airshow 2024 Catalogue. https://www.norinco.cn.
-
Unitree Robotics. “H1 Humanoid in Logistics.” https://www.unitree.com/news/h1_logistics_demo.
-
Ghost Robotics. “Vision 60 & SPUR: Special Purpose Unmanned Rifle.” https://www.ghostrobotics.io; https://www.sword-int.com.
-
China Central Television (CCTV). “Q-UGV Wolf Tactical Robot.” August 26, 2024. https://tv.cctv.com.
-
armasuisse. “ANYmal C in Military Trials.” Swiss Defence Procurement Agency Report 2025. https://www.vtg.admin.ch.
-
DRDO (India). “Humanoid Robotics Program.” https://www.drdo.gov.in/humanoid-robotics.
-
United Nations. “LAWS Working Paper 2025 (CCW/GGE.1/2025/WP.1).” UN Convention on Certain Conventional Weapons. https://documents.un.org.
II. Nutzenpotenziale humanoider Systeme
-
Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. “The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand.” NBER Working Paper No. 25682, 2019.
-
OECD. The Impact of AI on the Workplace – Findings from the OECD AI Surveys. Paris: OECD Publishing, 2025.
-
Morgan Stanley. Humanoids: A $5 Trillion Market. New York: Morgan Stanley Research, 2025.
III. Herausforderungen und strukturelle Grenzen
- OECD. Artificial Intelligence in Society. Paris: OECD Publishing, 2019. https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.
IV. Politökonomische Implikationen
-
European Commission. White Paper on Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust. Brussels, 2020.
-
United Nations Office for Disarmament Affairs (UN ODA). Convention on Certain Conventional Weapons (CCW): Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). https://www.un.org/disarmament.
