KI: Mehr Leistung, weniger Miteinander
Was Organisationen jetzt tun müssen
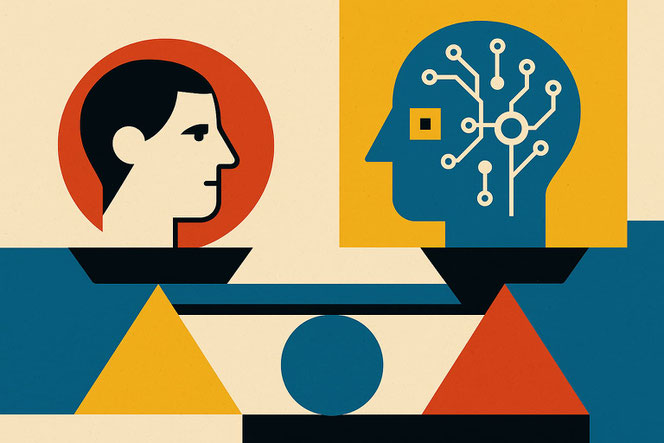
Einleitung: Das Problem im Hintergrund
Die Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt mit hoher Geschwindigkeit. Sie automatisiert Prozesse, steigert die Effizienz und wird zunehmend als aktiver Bestandteil in Teams
integriert. In zahlreichen Fällen lässt sich der Produktivitätszuwachs zweifelsfrei nachweisen. Gleichzeitig beginnt ein tiefgreifender Umbau der Zusammenarbeit. Während die Leistung steigt,
gerät das soziale Gefüge im Team zunehmend unter Druck.
Vertrauen, spontane Abstimmung und kollektives Lernen verlieren allmählich an Bedeutung. Es handelt sich dabei um einen Wandel, der geräuschlos verläuft, aber tief in bestehende Strukturen
eingreift.
1. Der Stand der Dinge
Nahezu alle Unternehmen investieren mittlerweile in Künstliche Intelligenz. Dennoch fühlt sich laut einer aktuellen Studie von McKinsey nur ein Prozent organisatorisch und kulturell ausreichend vorbereitet, um KI sinnvoll und wirkungsvoll zu integrieren. Die Technik ist längst vorhanden, es mangelt jedoch an Orientierung und Führungsfähigkeit.
Mehr als 80 Prozent der Führungskräfte rechnen damit, dass die KI nicht nur Prozesse, sondern auch die Teamkultur grundlegend beeinflussen wird. Das World Economic Forum prognostiziert zudem, dass bis zum Jahr 2030 rund 39 Prozent der heute relevanten beruflichen Kompetenzen durch neue ersetzt oder grundlegend verändert werden. Es entsteht ein Handlungsdruck, der weit über die Technologie hinausreicht.
2. Drei Branchen - ein Muster
🔹 Industrie: Produktivität nimmt zu, Kommunikation nimmt ab
In der industriellen Fertigung senken sogenannte Factory Agents die Trainingszeiten um bis zu 40 Prozent, während gleichzeitig die Erstqualitätsrate um 30 Prozent steigt. Diese Systeme führen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Arbeitsprozesse, erkennen Fehler frühzeitig und schlagen individuelle Lernpfade vor.
Laut Revalize setzen bereits 43 Prozent der Werke auf KI-gestützte Qualitätskontrolle. 70 Prozent erhöhen ihre Software-Budgets, und 57 Prozent erweitern ihre Engineering-Teams, um Daten- und
Prozesskompetenz besser zu verknüpfen.
Mit dem Effizienzgewinn geht aber auch ein Verlust an persönlichem Austausch einher. Die Übergaben werden automatisiert, die Abstimmungen in das System verlagert und viele Gespräche entfallen.
Die Entscheidungen basieren zunehmend auf Dashboards anstelle von direktem menschlichen Dialog.
Die Konsequenz lautet: Technologische Systeme entfalten ihr Potenzial nur dann vollständig, wenn zur gleichen Zeit der soziale Raum aktiv gestaltet wird.
🔹 Gesundheitswesen: Entlastung entsteht, jedoch auf Kosten der Zusammenarbeit
In vielen Kliniken steuern KI-Agenten inzwischen komplette Patientenpfade, die sich von der Aufnahme über die Behandlung bis hin zur Entlassung erstrecken. Diagnostische Systeme erkennen
Schlaganfälle oder Frakturen deutlich schneller als der Mensch. Digitale Assistenten übernehmen Standardanfragen und entlasten das medizinische Personal spürbar.
Der fachübergreifende Austausch nimmt jedoch spürbar ab. Übergaben, Fallbesprechungen und interdisziplinäre Diskussionen werden zunehmend durch automatische Dokumentation ersetzt. Der informelle,
aber häufig entscheidende Dialog zwischen Ärzten, Pflegekräften und der Verwaltung droht zu verschwinden.
Eine mögliche Antwort darauf sind neue Strukturen wie die sogenannten AI Clinical Councils, in denen medizinische, datentechnische und ethische Perspektiven systematisch zusammengeführt werden.
Nur durch solche Formen der Integration kann der menschliche Kern der Versorgung erhalten bleiben.
🔹 Softwareentwicklung: KI als dritter Partner im Team
In der Softwareentwicklung ist der Einsatz von KI besonders weit fortgeschritten. 97 Prozent der Entwickler nutzen mittlerweile Tools wie GitHub Copilot. Diese Assistenten übernehmen
Routinetätigkeiten, dokumentieren Code oder generieren Funktionen. Die Zeitersparnis ist erheblich, der Fokus verschiebt sich zunehmend von der Ausführung zur Architektur.
Allerdings zeigen Studien, dass es bei komplexen Aufgaben auch zu Leistungseinbußen kommt. Eine Untersuchung des METR-Instituts dokumentiert einen Rückgang der Effektivität um bis zu 19 Prozent
bei erfahrenen Entwicklern, wenn der KI zu stark vertraut wird.
Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an Spielregeln, an neuen Rollenprofilen und an einer Kultur technischer Mündigkeit. Andernfalls entsteht ein paradoxer Effekt: Das Team wird scheinbar
schneller, verliert jedoch an Tiefe und Klarheit.
3. Auswirkungen von KI auf die Teamdynamik
Unabhängig von Branche oder Reifegrad zeigen sich drei übergreifende Muster, die für die meisten Formen der Zusammenarbeit relevant sind:
3.1. Die Kommunikation wird seltener, aber stärker formalisiert
Ein wachsender Teil der Abstimmungen erfolgt über Systeme. Die Effizienz steigt, doch der informelle Austausch geht zurück. Spontane Rückkopplung und soziale Resonanz werden seltener.
3.2. Die Rollen verändern sich
Die Künstliche Intelligenz übernimmt Routinetätigkeiten, analysiert Daten und bereitet Entscheidungen vor. Damit verändern sich die Anforderungen an das einzelne Teammitglied. Gefordert sind
sowohl ein systemisches Verständnis als auch digitale Urteilskraft und eine hohe Anpassungsfähigkeit.
3.3. Die Beiträge werden sichtbarer
Leistungen lassen sich zunehmend erfassen, vergleichen und bewerten. Das kann motivieren, erhöht jedoch auch den Druck, insbesondere dort, wo Maßstäbe unklar sind oder Rückzugsräume fehlen.
Diese Entwicklungen greifen tief in die Kultur der Zusammenarbeit ein. Wer sie nicht mitdenkt, riskiert eine Verschiebung der Dynamik im Team, die langfristig Vertrauen und Stabilität untergräbt.
4. Handlungsbedarf für Organisationen
4.1. Die Führung als gestaltende Kraft etablieren
Die Einführung von Künstlicher Intelligenz ist keine rein technische Entscheidung. Sie verändert die Rollenverteilung, die Entscheidungswege und das Verständnis von Verantwortung. Organisationen
brauchen Führungen, die diesen Wandel aktiv gestalten. Dazu gehören ein klares Zielbild, eine verlässliche Kommunikation, ein realistisches Erwartungsmanagement sowie die Fähigkeit, Spannungen im
Prozess aufzufangen. Der Einsatz von KI verlangt nach Orientierung. Diese Orientierung muss von der Führung überzeugend vermittelt werden.
4.2. Ein neues Kompetenzprofil aufbauen und fördern
Mit dem Einsatz von KI ändern sich die Anforderungen an die Beschäftigten. Das fachliche Wissen bleibt bedeutsam, reicht aber nicht mehr aus. Gefordert ist die Fähigkeit zur interdisziplinären
Zusammenarbeit, ein grundlegendes Verständnis für Daten und Systeme, digitale Urteilskraft sowie eine hohe Lernbereitschaft. Eine Organisation sollte gezielt in die Entwicklung dieser Fähigkeiten
investieren. Lernformate sollten praxisnah, kontinuierlich und teamorientiert gestaltet werden.
4.3. Die Einführung von KI schrittweise und mit klarer Zielsetzung gestalten
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sollte nicht gleichzeitig in allen Bereichen erfolgen. Sinnvoll ist ein gestufter Ansatz mit Pilotprojekten, die konkrete Fragestellungen bearbeiten und
deren Ergebnisse ausgewertet werden können. Klare Zielsetzungen, messbare Kriterien und eine verbindliche Einbindung der Führung sind hierfür entscheidend. Neben der technischen Integration ist
auch die Anschlussfähigkeit an bestehende Arbeitsweisen zu berücksichtigen. Neue Systeme entfalten ihren Nutzen nur dann, wenn sie nachvollziehbar eingeführt und im betrieblichen Alltag
akzeptiert werden.
4.4. Den Umgang mit wachsender Transparenz verantwortungsvoll regeln
Der Einsatz von KI führt zu einer höheren Sichtbarkeit individueller Beiträge. Dadurch steigt der Vergleichsdruck innerhalb der Organisation. Es ist erforderlich, frühzeitig festzulegen, welche
Leistungen erfasst, wie sie bewertet und welche Maßstäbe angelegt werden. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie qualitative Beiträge berücksichtigt werden, die sich nicht unmittelbar messen
lassen. Ziel muss es sein, Leistung sichtbar zu machen, ohne sozialen Druck in destruktive Bahnen zu lenken. Die Steuerung dieser Dynamik gehört zur Führungsverantwortung.
4.5. Die psychologische Sicherheit und den sozialen Zusammenhalt sichern
Ein vertrauensvolles Arbeitsklima ist eine notwendige Bedingung für produktive Veränderung. Die Einführung von KI kann Verunsicherung auslösen und bestehende Rollen infrage stellen. Umso
wichtiger ist es, den sozialen Rückhalt im Team zu pflegen und gezielt zu stärken. Dazu zählen offene Kommunikationsräume, transparente Entscheidungswege und eine Führungskultur, die Rückfragen
zulässt und Verantwortung fördert. Eine Organisation darf Produktivität nicht mit Rückzug oder innerer Distanz bezahlen. Die psychologische Sicherheit bildet das Fundament für nachhaltige
Leistungsfähigkeit.
5. Fazit: Fortschritt braucht Balance
Künstliche Intelligenz kann die Leistung von Teams erheblich steigern. Doch Leistung allein genügt nicht, wenn dabei das Zwischenmenschliche verloren geht. Eine zukunftsfähige Organisation muss beides im Blick behalten: die Effizienz in den Abläufen und die Verlässlichkeit im Miteinander.
Die Zukunft gehört nicht jenen, die schneller automatisieren, sondern denen, die technologische Effizienz mit kultureller Reife verbinden.
Workshop
Wie verändert Künstliche Intelligenz die Zusammenarbeit in Teams, in der Führung und in der Kultur eines Unternehmens?
In unserem Workshop „KI und Teamarbeit: Chancen nutzen, Zusammenhalt bewahren“ erarbeiten wir praxisnah, wie sich der digitale Wandel konstruktiv
gestalten lässt, ohne dass der soziale Zusammenhalt verloren geht.
Weitere Informationen zu Format, Inhalten und Anmeldung finden Sie hier.
