Was kostet ein Prinzip?
Betrachtungen zur Lage · Ausgabe 6
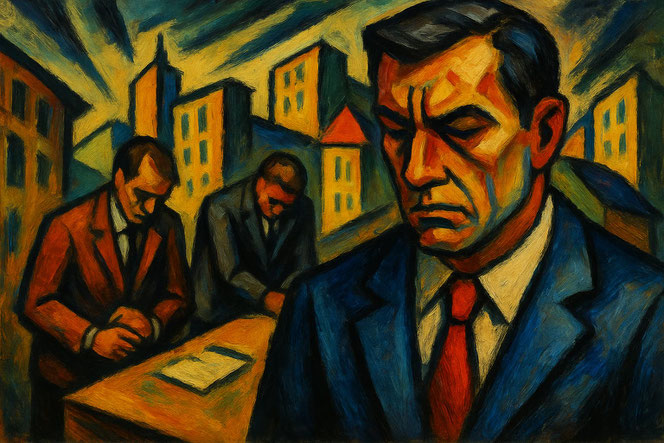
Über Ordnungspolitik in Zeiten der Beliebigkeit
Ordnungspolitik war einmal die leise, aber tragende Stimme der Wirtschaftspolitik. Sie formulierte keine Programme, sondern Prinzipien. Sie versprach nicht, alle Probleme zu lösen, sondern dafür zu sorgen, dass Lösungen überhaupt entstehen konnten – im Wettbewerb, durch Verantwortung, mit begrenzter Macht und klaren Zuständigkeiten. Heute gilt so etwas bestenfalls als naiv, schlimmstenfalls als neoliberal. In jedem Fall: als unmodern.
Denn unsere Zeit liebt das Situative. Das Spontane. Das Reaktive. Prinzipien gelten als starr, unflexibel und hinderlich. Die Politik „muss handeln“, heißt es dann. Möglichst sofort, möglichst kreativ und möglichst sichtbar. Ordnungspolitische Zurückhaltung wird als Tatenlosigkeit missverstanden, obwohl sie oft die anspruchsvollere Form politischen Handelns ist: nämlich die, sich nicht einzumischen, wo Marktprozesse bereits wirken.
Doch Prinzipien haben ihren Preis. Sie fordern Verzicht auf das schnelle Eingreifen, auf populäre Wohltaten und auf die Steuerung durch Subvention. Wer sich zur Ordnungspolitik bekennt, verzichtet auf kurzfristigen Applaus. Er gewinnt dafür etwas anderes: Glaubwürdigkeit, Planbarkeit und Vertrauen. Alles Dinge, die man nicht sofort in Umfragen messen kann, wohl aber in Investitionsentscheidungen, Vertragslaufzeiten und unternehmerischem Mut.
Beliebigkeit kostet langfristig mehr. Denn sie erzeugt Unsicherheit. Wenn heute der Markt gilt und morgen der Ministerentscheid, wenn Steuern nicht nach System, sondern nach Stimmung festgelegt werden, wenn Beihilfen nicht nach Bedarf, sondern nach Nähe verteilt werden, dann entsteht kein Raum für Gestaltung, sondern ein Sumpf aus Erwartung, Abhängigkeit und Enttäuschung.
Ordnungspolitik ist kein Dogma. Sie ist ein Rahmen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie schützt vor Machtkonzentration, vor Verantwortungslosigkeit und vor der Illusion, man könne über Regeln hinwegregieren, ohne dafür zu zahlen. Und sie erinnert daran, dass der Staat kein Unternehmer ist, sondern Schiedsrichter. Kein Investor, sondern Garant. Kein Gestalter im operativen Sinne, sondern Verwalter eines Spielfelds, auf dem andere handeln.
Die Frage ist nicht: Kann man heute noch ordnungspolitisch denken?
Die Frage ist: Was passiert, wenn man es nicht mehr tut?
Bilanzsatz:
Ein Prinzip ist teuer – kurzfristig.
Beliebigkeit ist teurer, und zwar dauerhaft.
Und Ordnung zahlt sich erst aus, wenn man auf sie verzichten könnte.
